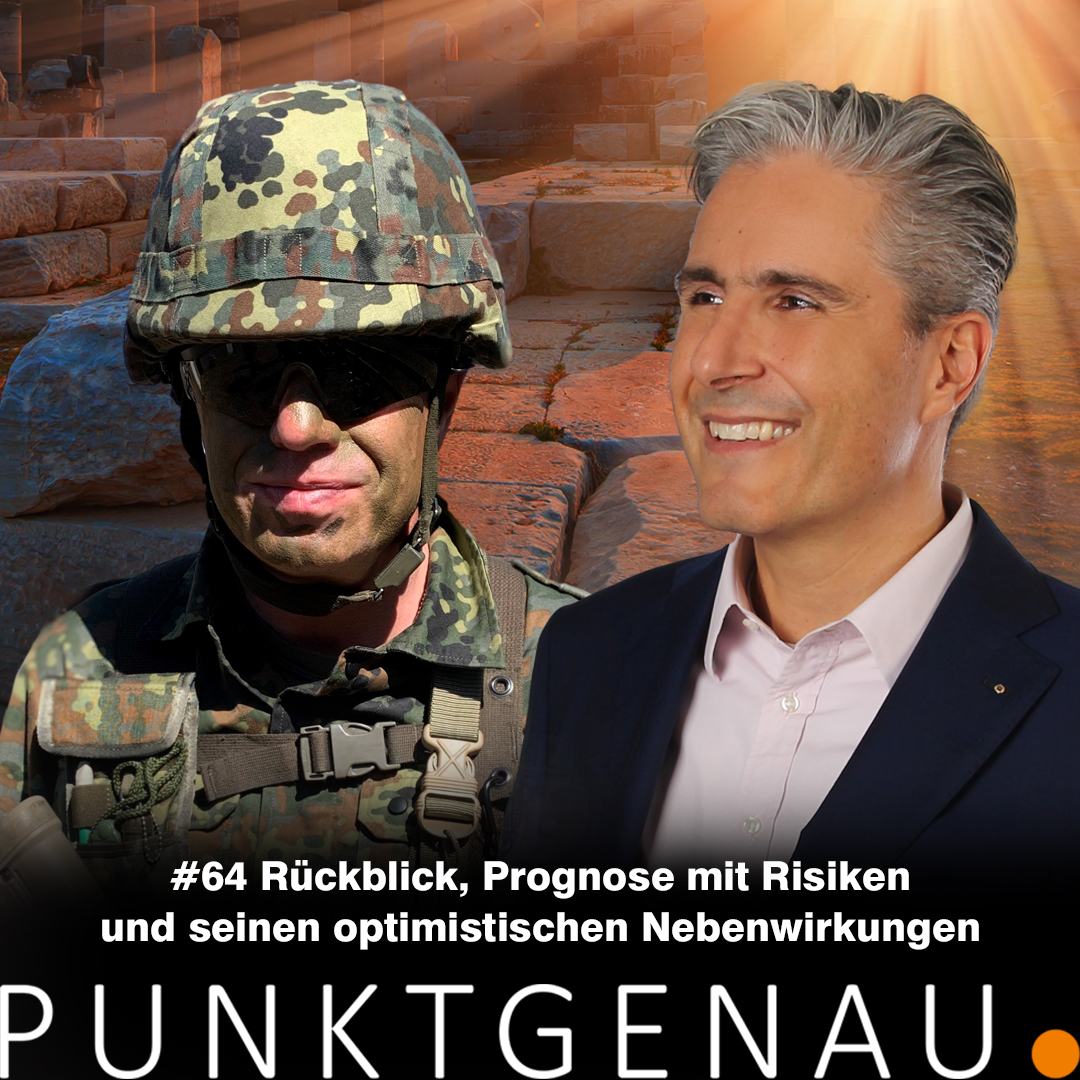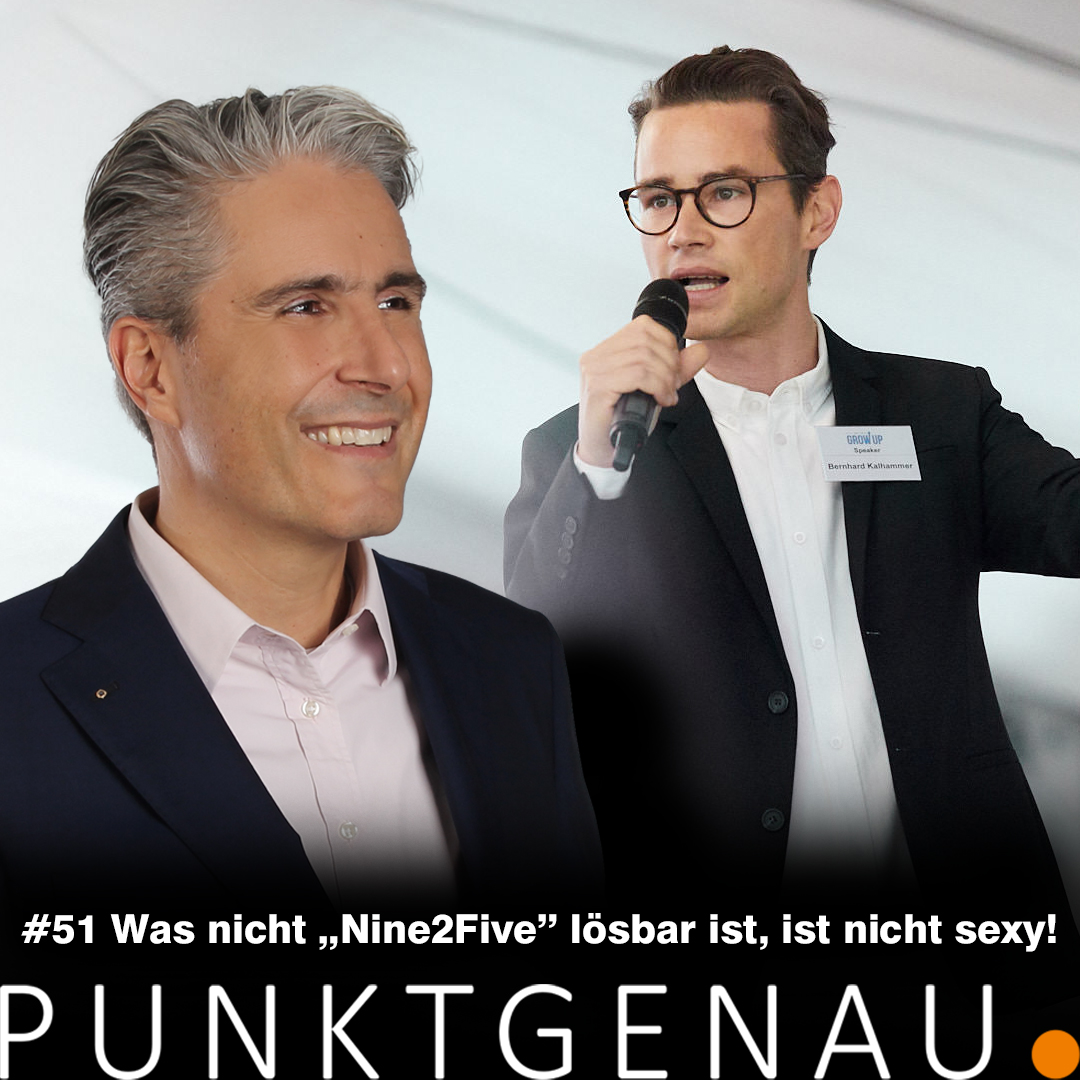Das ist das Motto der 2010 gegründeten Markenberatung Biesalski & Company, die für Unternehmen wie Rügenwalder, Trumpf, Katjes und Bosch arbeitet und es sich zum Ziel gesetzt hat, aus Emotionen Wertschöpfung zu machen. Im Gespräch erläutert der Geschäftsführende Gesellschafter Alexander Biesalski, was eine Marke ausmacht und was es bei deren Aufbau zu beachten gilt.
Was ist der Unterschied zwischen Name und Marke?
Ein Name ist im wirtschaftlichen Kontext eine Bezeichnung, um etwas zu identifizieren. Marke hingegen ist der bekannte Absender eines unverwechselbaren Produkts oder einer Dienstleistung, welche im Kopf und Herzen einer Zielgruppe verankert ist.
Kannst du in wenigen Sätzen erläutern, wie man eine Marke aufbaut?
Wir realisieren den Markenentwicklungsprozess wie einen Change-Prozess: Wir beginnen mit der grundsätzlichen Aufgabenstellung, Commitment zu schaffen, schaffen dann Wissen, und dann geht es in die eigentliche Königsdisziplin: Wollen und Können. In diesen Prozess eingebettet sind dann die klassischen Stufen der Markenentwicklung: Analyse, Identitätsdefinition, Strategiefestlegung, interne Implementierung, Kommunikation und Verhaltensentwicklung.
Was ist die größte Challenge in Unternehmen, wenn es um dieses Thema geht?
Das Schwierigste ist meist, die Menschen motiviert zu bekommen, sodass sie sich an der Veränderung beteiligen und sie tragen. Und da hat die Marke einen entscheidenden Vorteil, weil sie bei nahezu allen Mitarbeitenden zunächst einmal positiv konnotiert, ein wertvolles Ziel und damit ein enormer Motor für Veränderung ist. Wichtig ist dabei immer, dass Markenentwicklung niemals nur ein reine Marketingaufgabe ist, sondern alle Disziplinen im Unternehmen einbeziehen muss. Und dafür muss unbedingt der Vorstand beziehungsweise der oder die Inhaberin sichtbar mit voller Motivation dahinterstehen.
Als Finanzer will ich natürlich immer alles messbar machen. Unterstützt ihr Unternehmen auch bei der Definition von KPIs in Bezug auf das Thema Marke?
Wir kommen ja aus der monetären Bewertung von Marken, und im Rahmen dieser Markenbewertung erheben wir natürlich eine ganze Menge von Leistungsfaktoren, die letzten Endes die Stärke und die Performance einer Marke kennzeichnen – sowohl auf finanzwirtschaftlicher, als auch auf strategischer und operativer Ebene. Dabei wir haben herausgefunden, dass im Durchschnitt knapp 40 Prozent des Unternehmenswertes im B2B-Bereich auf die Marke entfällt. In Zeiten zunehmender Preisaggressivität im Markt und des Wettbewerbs aus Fernost bekommt das Thema zusätzlich Aufschwung, weil Unternehmer nochmal stärker auf den Aspekt der Marke, der eigenen Positionierung im Markt gucken.
Der Markt wird enger – das gilt natürlich auch für euch. Wie motivierst du deine eigenen Mitarbeiter?
Bei der Haltung zur Arbeit hat sich etwas verändert, zu einer 70-Stunden-Woche ist auch in der Beratung heute keiner mehr bereit. Heute ist die Situation für Absolventen deutlich komfortabler geworden als zu meinen Zeiten. Trotzdem verlange ich den Leuten nach wie vor etwas ab. Damit die also in deutlich weniger Arbeitszeit echte Top-Leistung bringen, haben wir Standards entwickelt. Damit können wir auch jungen Leuten relativ schnell Verantwortung geben, weil die Leute nicht ständig die Welt neu erfinden müssen und auf einen großen Schatz an Erfahrungen zurückgreifen können. Selbst die Praktikanten sind bei uns im Kundenkontakt dabei und werden vorgestellt – und das motiviert die Leute extrem.
Wenn du Unternehmern drei Tipps in Sachen Marke mitgeben könntest: Welche wären das?
Das Wichtigste ist ein klares Zielbild: Wo willst du hin? Danach ist es von entscheidender Bedeutung, den Mitarbeitern Verantwortung in der Umsetzung zu geben: Lass deine Leute mitgestalten. Und last but not least geht es nicht ohne Kontrolle: KPIs definieren und regelmäßig prüfen, ob das Ganze zum gewünschten Erfolg führt. Damit kann man ein Unternehmen wirklich nach vorne bringen.
Dieser Text ist ein Auszug aus meinem Podcast „punktgenau“, den Sie hier in voller Länge hören können.
Sie möchten Ihre Zukunftsfähigkeit auf den Prüfstand stellen? Dann melden Sie sich zu einem kostenfreien Erstgespräch bei mir und wir tauschen uns zu Ihrem Thema aus. Kontakt: info@fersadi.de
Sie möchten keinen meiner Blog-Beiträge mehr verpassen? Dann vernetzen Sie sich gerne bei XING und/oder LinkedIn mit mir!
Bild: austin.chain@unsplash.com